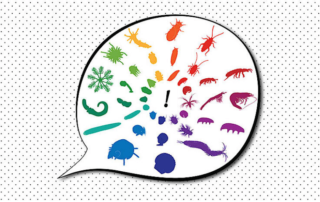Menschen rauchen weniger, wenn sie im Grünen leben
Menschen rauchen mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit und hören erfolgreicher auf, wenn sie in grünen Gegenden leben. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie mit Beteiligung von Psycholog*innen der Universität Wien, sowie der Universität Plymouth und der Universität Exeter, die den Zusammenhang zwischen grünem Lebensraum und dem Rauchverhalten in England untersuchte. Die Ergebnisse erscheinen in Social Science & Medicine.
THE World University Rankings 2021
Das Times Higher Education World University Ranking 2021 umfasst mehr als 1.500 Universitäten in 93 Ländern und bewertet die Leistung einer Hochschule in vier Bereichen: Lehre, Forschung, Wissenstransfer und internationale Perspektiven.
Moleküle zum „Aus-der-Haut-Fahren“
Jene Moleküle, die als Grundlage für die Häutung von Insekten und Krebstieren dienen, sind im Tierreich weit verbreitet und haben ihren Ursprung bereits in der Frühzeit des Stammbaums. Eine Gruppe von Forscher*innen um Andreas Wanninger von der Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Wien zeigt jetzt, dass nicht nur jene Tiere diese Moleküle besitzen, die sich tatsächlich häuten, sondern auch solche, die keine so drastische körperliche Entwicklung durchleben. Auch bei diesen sind die Häutungsmoleküle besonders in Phasen der Veränderung aktiv. Die Studie erscheint in Current Biology.
Die Vielfalt der Eiszeit-Hunde
Unmittelbar nach der Eiszeit hat es eine große Vielfalt von Hunden gegeben, die so heute nicht mehr existiert. Die heute noch bestehende Hundevielfalt stammt demnach aus einer Zeit, in der Menschen noch Jäger und Sammler waren. Zu diesen Ergebnissen kommt ein internationales Forschungsteam um Ron Pinhasi von der Universität Wien in Zusammenarbeit mit dem Francis Crick Institute und der Universität Oxford, das alte DNA von Hunden aus verschiedenen Weltregionen analysiert und verglichen hat. Die Studie erscheint in "Science".
Steigende Mietpreise für Studenten trotz Corona
Im Zuge der Corona-Pandemie hofften viele Studierende auf bessere Zeiten hinsichtlich der Wohnkosten. Sinkende Mieten schienen zu Beginn der Krise nicht unwahrscheinlich. Dies hat sich jedoch nicht bewahrheitet.
Mehr Platz: Uni Wien zieht in ehemalige Volksbankzentrale
Die Universität Wien und die Bundesimmobiliengesellschaft eröffnen einen neuen Standort in der Kolingasse in Wien Alsergrund. Die Bundesimmobiliengesellschaft adaptierte die ehemalige Zentrale der Volksbank als Unistandort mit 15.000 m². Der Universität Wien ermöglicht dieser Standort neue Schwerpunktsetzungen in Forschung und Lehre. Möglich gemacht hat dies die deutliche Budgetsteigerung durch die Umstellung auf die Unifinanzierung NEU.
Dramatischer Energieumsatz ab etwa 1950: „Wie großer Meteoriteneinschlag“
Menschheit verbrauchte seit Mitte des 20. Jahrhunderts mehr Energie als in den 11.700 Jahren davor
Mit Wissenschaft gegen die mediale Verbreitung von Fake News
Wie kann die Wissenschaft helfen, die mediale Verbreitung von falschen Informationen hintanzuhalten? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein EU-Forschungsprojekt an der Universität Wien. Erste Ergebnisse von Fachdidaktiker*innen für politische Bildung um Dirk Lange liegen nun vor: Fallstudien behandeln kontroverse Themen wie das 5G-Netzwerk, den Ausbruch von Covid-19, den Klimawandel und die Berichterstattung über Migration und Geflüchtete. Sie sollen in Leitlinien für evidenzbasierte Kommunikation zur Verringerung des Risikos irreführender Informationen münden und in der Folge in Lehr- und Lernstrategien einfließen.