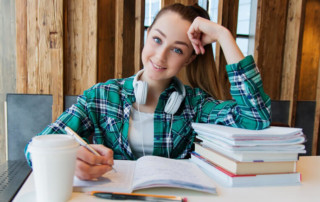Mit Chemie das Klima schützen
ForscherInnen der Universität Graz entwickeln biobasierte Kunststoff-Bausteine aus Abfall der Papierindustrie
Untergang der Liangzhu-Hochkultur durch Klimaveränderung verursacht
Als „Chinas Venedig der Steinzeit“ bezeichnet, gilt die Ausgrabungsstätte Liangzhu in Ost-China als eines der bedeutsamsten Zeugnisse der frühen chinesischen Hochkultur. Vor mehr als 5000 Jahren verfügte die Stadt bereits über eine komplexe Wasserversorgung. Was zum plötzlichen Kollaps führte, war bisher umstritten. Massive Überschwemmungen, ausgelöst durch anomal intensive Monsunregen, verursachten den Zusammenbruch, wie ein internationales Team mit Beteiligung des Innsbrucker Geologen und Klimaforschers Christoph Spötl im Fachmagazin Science Advances nun zeigt.
Macht der Gewohnheit: Pre-Performance-Routine bringt Vorteile für Athlet*innen
Viele hervorragende Sportler*innen haben eine Routine, die sie unmittelbar vor einer sportlichen Aufgabe ausführen. Aber helfen diese Angewohnheiten tatsächlich, ihre Leistung zu steigern? Anton Rupprecht und Ulrich Tran von der Fakultät für Psychologie und der Sportpsychologe Peter Gröpel vom Institut für Sportwissenschaft haben nun Daten über verschiedene Sportarten und Leistungsniveaus hinweg analysiert. Die Ergebnisse belegen, dass Routinen für Anfänger*innen wie auch Spitzensportler*innen Vorteile bringen. Die Studie erscheint in der International Review of Sport and Exercise Psychology.
Tiefgreifender ökologischer Wandel im östlichen Mittelmeer
Gemeinschaften aus eingeschleppten tropischen Arten unterscheiden sich in ihren biologischen Eigenschaften deutlich von der heimischen Tierwelt im östlichen Mittelmeer, wie ein internationales Forscherteam um Jan Steger vom Institut für Paläontologie herausfand. Dadurch – und durch den fortschreitenden Kollaps mediterraner Arten – verändern sich die Flachwasser-Ökosysteme in der Region besonders tiefgreifend. Die Studie wurde im Fachjournal Global Ecology and Biogeography veröffentlicht.
Keine gefährliche Strahlung von Haustier-Trackern
Tracker für Haustiere werden immer beliebter. Aus gutem Grund, denn der Tracker ist eine Möglichkeit, ergänzend zur Kennzeichnung und Registrierung der Haustiere, diese vor dem endgültigen Verschwinden zu schützen. Doch wie sieht es mit der von den Trackern ausgehenden Strahlung aus? Und wie wirkt diese in Kombination mit der Strahlung von anderen elektronischen Geräten? Eine soeben veröffentlichte Studie der Vetmeduni gibt Entwarnung: Die Strahlenwerte der elektromagnetischen Hochfrequenzfelder liegen deutlich unter den geltenden Grenzwerten – die Wissenschafter:innen haben dennoch einige Tipps für Haustierhalter:innen, um die Strahlenbelastung weiter zu reduzieren.
Warum haben Menschen einen verdrehten Geburtskanal?
Der enge menschliche Geburtskanal ist im Lauf der Evolution vermutlich als "Kompromisslösung" entstanden um unterschiedlichen Anforderungen zu genügen: der Geburt, der Unterstützung der inneren Organe und dem aufrechten Gang. Aber nicht nur die Tatsache, dass der Geburtskanal eng ist, sondern auch seine komplexe "verdrehte" Gestalt ist ein evolutionäres Rätsel. Katya Stansfield von der Universität Wien hat mit internationalen Kolleg*innen untersucht, weshalb sich diese ungewöhnliche Form entwickelt hat. Die Ergebnisse ihrer Forschung wurden im Fachmagazin BMC Biology veröffentlicht.
Forschungsgruppe entdeckt Schlüsselelement der Wundheilung
Eine internationale Studie unter Beteiligung der Vetmeduni hat nun herausgefunden, dass Natürliche Killerzellen (NK Zellen) die Wundheilung der Haut regulieren. Die Studie zeigt auf, dass eine ausreichende antimikrobielle Abwehr der Haut auf Kosten einer begrenzten Reparaturkapazität geht, während eine Beschleunigung der physiologischen Wundheilung mit einem geringeren Infektionsschutz verbunden ist. Laut den Forscher:innen hat die Evolution für diesen Konflikt gut vorgesorgt – mit dem Transkriptionsfaktor HIF-1α identifizierten sie in den „Killerzellen“ jenes Schlüsselelement, das für die nötige Balance sorgt.
Ist Ghostwriting an der Uni erlaubt?
Studierende stehen unter einem enormen Druck. Sie wollen ihr Studium in der Regelstudienzeit abschließen, müssen Prüfungen bestehen und haben nicht selten einen Nebenjob, um sich die Zeit an der Uni zu finanzieren. Gleichzeitig muss die Abschlussnote möglichst gut sein, damit nach dem Studium ein lukrativer Job winkt. Nicht wenig Studierende entschließen sich im Laufe ihres Studiums dazu, einen Ghostwriter zu beauftragen, der eine wissenschaftliche Arbeit für sie schreibt. Doch ist das überhaupt legal? Und wo liegen die Grenzen des Ghostwriting?