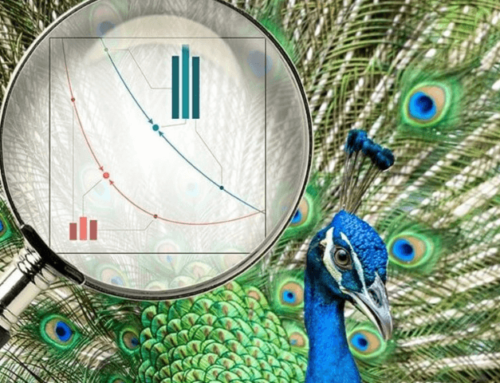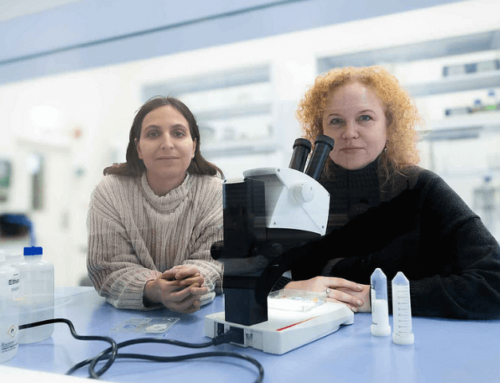Die Automatisierung in der Landwirtschaft schreitet rasant voran und KI-gestützte Werkzeuge gewinnen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere generative KI-Modelle wie große multimodale Modelle (LMMs) bieten neue Möglichkeiten, um das Wohl von Nutztieren auf individueller Ebene zu bewerten und zu verbessern. Die Studie zeigt jedoch, dass die Entwicklung solcher Systeme mit zahlreichen Herausforderungen verbunden ist.
Technologische Herausforderungen
Eine der zentralen Schwierigkeiten liegt in der Auswahl geeigneter Indikatoren für das Tierwohl. Bestehende Protokolle wie das Welfare Quality Protocol (WQP) wurden ursprünglich für menschliche Beobachter entwickelt und müssen für KI-Anwendungen angepasst werden. Besonders die kontinuierliche Messung und Bewertung affektiver Zustände stellt eine Herausforderung dar, da hierfür bislang keine validierten Indikatoren existieren. Ebenso entscheidend ist die Qualität der zugrunde liegenden Datensätze, sogenannte Goldstandards. Mangelnde Vielfalt und Zuverlässigkeit in diesen Datensätzen können die Generalisierbarkeit der Modelle erheblich einschränken.
„Die größte Herausforderung besteht darin, KI-Systeme zu entwickeln, die nicht nur präzise, sondern auch ethisch vertretbar sind. Wir müssen sicherstellen, dass die Technologie die Bedürfnisse der Tiere wirklich widerspiegelt und nicht nur auf Effizienzsteigerung abzielt,“ erklärt Studien-Co-Autor Christian Dürnberger vom Messerli Forschungsinstitut der Vetmeduni.
Die Studie hebt hervor, dass generative KI-Modelle wie GPT-4o vielversprechend sind, jedoch weitere Optimierungen benötigen. Ein Fallbeispiel zur Bewertung der Sauberkeit von Milchkühen ergab moderate Ergebnisse: Die Genauigkeit bei der Bewertung von Hinterbeinen lag bei 71 %, während die Präzision mit 63 % etwas niedriger ausfiel. Segmentierte Bilder, die nur das relevante Körperteil zeigen, lieferten die besten Ergebnisse. Dennoch zeigte das Modell eine Tendenz, Bilder als „schmutzig“ zu klassifizieren, was auf Schwierigkeiten bei der räumlichen Erkennung hinweist.
Ethische Aspekte und der One Welfare-Ansatz
Neben den technologischen Herausforderungen beleuchten die Wissenschafter:innen auch ethische und soziale Aspekte. Unterschiedliche gesellschaftliche Werte und regionale Unterschiede in der Landwirtschaft erfordern transparente und anpassungsfähige Lösungen. Die Studienautor:innen betonen, dass die Einbindung von Expert:innen aus dem Bereich der Tierwohlwissenschaften entscheidend ist, um valide und praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Gleichzeitig warnen sie vor möglichen „Rebound-Effekten“, bei denen Landwirt:innen sich zu stark auf KI-basierte Systeme verlassen und die persönliche Beobachtung der Tiere vernachlässigen könnten.
Die Forscher:innen plädieren für einen One Welfare-Ansatz, der Tierwohl, menschliches Wohlbefinden und Umweltschutz integriert. KI-gestützte Systeme könnten als „Co-Piloten“ unterstützen, die datenbasierte Empfehlunge geben, ohne menschliche Entscheidungen vollständig zu ersetzen. Dies könnte die Entscheidungsfindung verbessern und gleichzeitig die Vielfalt der Wissensquellen aufrechterhalten. „Künstliche Intelligenz sollte als Werkzeug verstanden werden, das Landwirt:innen unter die Arme greift, jedoch nicht ersetzt. Nur durch die Kombination von menschlichem Fachwissen und KI-gestützten Analysen können wir nachhaltige Verbesserungen im Tierwohl erreichen,“ betont Studienerstautorin Borbala Foris, Zentrum für Tierernährung und Tierschutzwissenschaften der Vetmeduni. KI-basierte Systeme hätten das Potenzial, das Tierwohl erheblich zu verbessern, wenn sie sorgfältig entwickelt und implementiert werden. Die Einbindung von Tierwohlwissenschafter:innen, die Berücksichtigung ethischer Prinzipien und die Entwicklung robuster Technologien sind entscheidend, um die Vorteile dieser Systeme voll auszuschöpfen. Gleichzeitig müssen politische Entscheidungsträger:innen, Landwirt:innen sowie die Gesellschaft zusammenarbeiten, um die Akzeptanz und den Nutzen dieser Technologien zu maximieren.
Der Artikel „AI for One Welfare: the role of animal welfare scientists in developing valid and ethical AI-based welfare assessment tools” von Borbala Foris, Kehan Sheng, Christian Dürnberger, Maciej Oczak und Jean-Loup Rault wurde in Frontiers in Veterinary Science veröffentlicht.