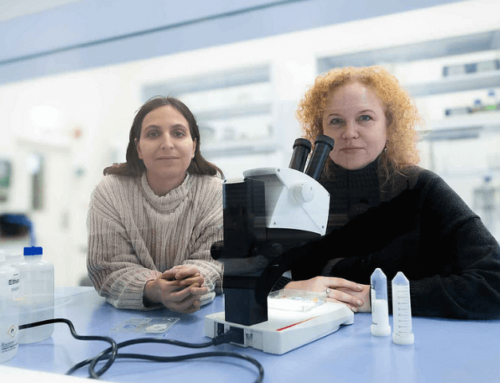Nicht nur unsere Umwelt ist voll damit, auch in den Kläranlagen häuft sich Mikroplastik. „Bis zu 95 Prozent der größeren Kunststoffstücke können mit bisherigen Verfahren entfernt werden“, berichtet Raquel Gonzalez de Vega. „Häufig werden aber winzige Teile unter 20 Mikrometer übersehen“, so die Uni-Graz-Chemikerin.
In Zukunft wird ein zusätzlicher Behandlungsschritt erforderlich sein, um diese Schadstoffe besser bekämpfen zu können. Eine neue EU-Abwasserrichtlinie verpflichtet große Kläranlagen, eine vierte Stufe einzuführen. Diese sieht unter anderem den Einsatz von Ozon vor, um Mikroverunreinigungen wie Rückstände aus Kosmetika und Medikamenten zu entfernen.
Kleine Teile, großer Einfluss
„Doch das Mikroplastik verschwindet nicht. Es wird durch Ozon, das eine Oxidation des Kunststoffes bewirkt, immer kleiner“, stellte Gonzalez de Vega im Zuge ihrer Analysen fest.
Diese Kunststoff-Nanopartikel sind nicht nur winzig, sondern auch extrem mobil. „Je kleiner sie werden, desto größer ist ihr potenzieller Einfluss auf die Umwelt“, warnt die Chemikerin, „da sie leichter mit Organismen und Ökosystemen interagieren können.“
Das Paradoxon dabei: Kläranlagen, die eigentlich zum Schutz vor Kunststoffabfall gedacht sind, können auch als Quelle für neue Mikropartikel dienen.
Dieser Herausforderung werden Gonzalez de Vega und ihr Team mit weiteren Forschungen begegnen. „Wir wollen Ozon mit UV-Licht kombinieren und den Einsatz anderer Katalysatoren testen, um die Bildung von Mikro- und Nano-Kunststoff besser bewerten und kontrollieren zu können“, sagt Raquel Gonzalez de Vega.
Die Erkenntnisse wurden kürzlich im Fachjournal of Analytical Atomic Spectrometry veröffentlicht. Darin wird die Forscherin am Institut für Chemie als aufstrebende Analytikerin (emerging analytical scientist) hervorgehoben.